Konfliktzone/ Decoding Conflicts
Autoren: diverse, 26 min, berlin producers & storyline im Auftrag des ZDF und DW, in Zusammenarbeit mit arteKonfliktzone: Huthi-Rebellen im Jemen
Ein Film von Martin Koddenberg und Lina Schuller
jetzt in der arte-Mediathek und auf YouTube.


Der Jemen am südlichsten Zipfel der Arabischen Halbinsel gehört zu den ärmsten Ländern der Welt. Eigentlich ein Land mit einer reichen Kultur und Historie, herrscht hier nach 10 Jahren Bürgerkrieg bittere Not: zerstörte Städte, fehlende Versorgung, systematische politische Repression. Eine verlorene Generation von Kindern wächst ohne Schulbildung, ohne medizinische Versorgung und ohne Nahrung auf. Hilfslieferungen werden blockiert, geplündert oder auf dem Schwarzmarkt verkauft.
Das Elend des Landes geht auf das Konto der radikal-islamischen Huthis. Seit Jahren kämpft die Miliz gegen die international anerkannte Regierung des Jemen. Über 400.000 Menschen starben bereits an den Folgen des Krieges. Mehr als 20 Millionen Menschen sind auf humanitäre Hilfe angewiesen – rund die Hälfte der Bevölkerung.
Seit Oktober 2023 ist aus dem lokalen Konflikt ein regionaler geworden: Seither greifen die Huthis verstärkt internationale Handelsschiffe im Roten Meer an – offiziell, um die Palästinenser im Gaza-Krieg gegen den Erzfeind Israel zu unterstützen.
Trotz jahrelanger Luftschläge und internationaler Interventionen gelang es weder Saudi-Arabien noch der UN-gestützten Regierung, die Huthis zu besiegen. Die Miliz hat sich im Chaos des Bürgerkriegs zur dominierenden Kraft im Land entwickelt. Geschickt nutzt sie Krieg, Religion und Notstand, um ihre Macht weiter auszubauen – und sich als Bollwerk gegen den Westen zu präsentieren.
Ohne Waffenstillstand und eine neue politische Strategie droht der Jemen, immer weiter zwischen Blockade, Gewalt und internationaler Einflussnahme zerrieben zu werden.
Konfliktzone: Transnistrien – Pulverfass im Osten Europas
Ein Film von Martin Koddenberg und Lina Schuller
jetzt in der arte-Mediathek und auf YouTube.


Transnistrien ist ein Landesteil der Republik Moldau, faktisch jedoch ein Staat im Staat – mit eigener Flagge, eigener Währung und eigener Regierung. Die selbsternannte Republik ist international nicht anerkannt, aber seit Jahrzehnten politisch, wirtschaftlich und militärisch eng mit Russland verflochten. Rund 1.500 russische Soldaten sind dauerhaft in der Region stationiert. Im Frühjahr 2022 kommt es zu Explosionen und Angriffen auf Behördengebäude – kurz nach dem russischen Einmarsch in die Ukraine. Ein Zufall?
Der sogenannte „eingefrorene Konflikt“ zwischen Transnistrien und der Republik Moldau birgt erhebliches Eskalationspotenzial. Während die Regierung in Chisinau einen pro-europäischen Kurs verfolgt, halten viele Menschen in Transnistrien an Russland fest, trotz tiefer Armut im Land.
Die Wirtschaft der Region wird von einem mächtigen Oligarchen-Netzwerk dominiert. Kritiker sprechen von einem System gegenseitiger Absicherung zwischen Wirtschaft, Politik und pro-russischen Machtstrukturen. Bis Anfang 2025 beruhte Transnistriens Ökonomie auf kostenlosem Gas aus Russland – obwohl rund 80 Prozent der Exporte in die EU fließen. Ein paradoxes Konstrukt. Die Energiekrise nach dem Gasstopp hat die Spannungen in der Region verschärft. Spätestens seit Moldau 2022 den Status eines EU-Beitrittskandidaten erhalten hat, rückt die lange vergessene Region wieder ins Zentrum geopolitischer Machtspiele.
Während Oligarchen und prorussische Akteure auf Destabilisierung setzen, wächst der Druck auf die moldauische Regierung – und auf Europa, klar Stellung zu beziehen.
Konfliktzone: Mexiko – Krieg der Drogen-Kartelle
Ein Film von Martin Koddenberg

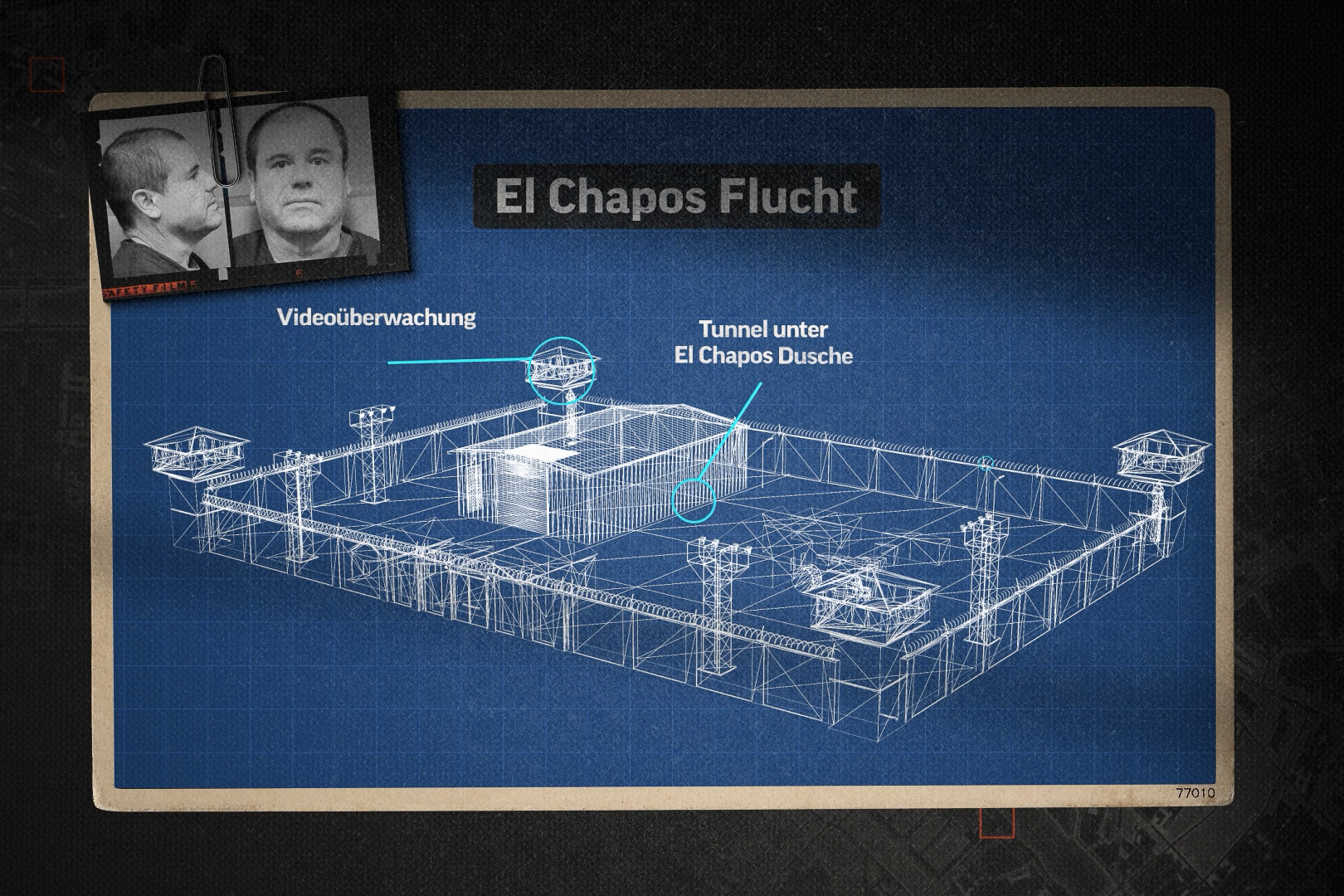
Mexiko steht seit Jahrzehnten im Zentrum eines eskalierenden Drogenkriegs. Über 400.000 Menschen wurden seit 2006 getötet, mehr als 125.000 gelten als verschwunden. Drogenkartelle kontrollieren weite Teile des Landes, während der Staat von Korruption zerfressen und von Ohnmacht gelähmt ist.
In Städten wie Tijuana, Culiacán oder Doctor Coss liefern sich bewaffnete Banden Gefechte mit selbstgebauten „Narco-Tanks“. Massengräber in Wohngebieten sind keine Ausnahme. Viele Opfer bleiben namenlos. Wer verschwindet, war oft nur zur falschen Zeit am falschen Ort.
Mexiko ist ein zentrales Transitland im globalen Drogennetzwerk. Kokain aus Südamerika, Methamphetamin aus inländischen Laboren und die synthetische Droge Fentanyl gelangen von hier aus in die USA und weiter nach Europa, Asien und Afrika. Im Gegenzug fließen Geld und Waffen zurück. Der illegale Handel ist ein Milliardengeschäft – und macht die Narco-Bosse zu mächtigen Akteuren.
Die Kartelle rekrutieren gezielt junge Männer aus armen Regionen, versprechen Einkommen, Aufstieg und Schutz. Sie unterwandern Behörden, Justiz, Polizei und Militär. Der Fall der 43 verschwundenen Studenten von Ayotzinapa zeigte 2014, wie eng organisierte Kriminalität und staatliche Stellen kooperieren.
Die Gewalt ist systemisch. Die Angst – allgegenwärtig. Doch der Konflikt betrifft längst nicht nur Mexiko. Die USA als Hauptzielland der Drogen aus Mexiko erhöhen den Druck – und schließen militärisches Eingreifen nicht mehr aus.

