PSYCHO, Staffel 2
Autoren: diverse, 26 min, arte

Sarah ist 24 Jahre alt, als sie eine E-Mail bekommt, deren Inhalt sie nicht mehr versteht. Die Arbeit in einem Startup hat sie so ausgepowert, dass nichts mehr geht. Sie schämt sich. Statt etwas zu leisten, liegt sie nur herum. Dieses Gefühl der Wertlosigkeit begleitet viele Burnout-Betroffene. Sie suchen den Fehler bei sich selbst, greifen zu Alkohol und Medikamenten, um sich Linderung zu verschaffen und um weiter durchhalten zu können.
So geht es auch Dimitri. Der Vertriebsleiter aus Paris greift abends immer häufiger zu Alkohol. Seine Frau macht sich Sorgen. Das ignoriert Dimitri. Erst ein unangenehmes Zucken im Auge, bringt ihn zum Arzt. Er steht kurz vor einem Schlaganfall. 18 Monate ist das her, seitdem ist er mit Burnout krankgeschrieben. Auch er schämt sich, spricht nur mit seinem engsten Freund darüber.
Amélie war gerne Krankenschwester. Bis sie eines Tages einen Patienten anschreit. Danach beginnt sie zu weinen und kann nicht mehr aufhören. Ein Jahr braucht die junge Frau, bis sie wieder zu Kräften kommt. Eine Selbsthilfegruppe auf einem Segelboot hilft ihr dabei. Zurück ins Krankenhaus aber kann sie nicht mehr.
Magdalena Wekenborg forscht seit 10 Jahren an der TU Dresden zu Burnout. Sie erklärt, dass die Arbeitsbedingungen sich enorm verdichtet haben. Dauerstress ist Normalzustand. Menschen im Burnout können diesen permanenten Stress nicht mehr regulieren. Sie laufen immer auf Hochtouren, selbst ihr Herzschlag reagiert nicht mehr flexibel. Dieser Erschöpfungszustand ist keine Modeerkrankung, sondern eine ernsthafte Folge krankmachender Arbeitsverhältnisse.


Chronische Schmerzen bestimmen das Leben der Betroffenen jeden Tag. Meggie ist 25 Jahre alt. Sie leidet an schwerer Migräne. Sobald die Schmerzen einsetzen, muss sie alles stehen und liegen lassen. Ihre Arbeit als Tanzlehrerin musste sie aufgeben, weil sie die Stunden nicht mehr durchhalten konnte. Heute studiert sie Soziale Arbeit, fährt Skateboard und versucht, ihren Alltag rund um die Schmerzen herum zu gestalten.
Auch Charlie lebt seit der Geburt ihrer zweiten Tochter mit ständigen Schmerzen. Ein Riss in der Gebärmutter versetzt ihr täglich „Stromschläge“. Trotz eines Medikamentencocktails und anhaltender Schmerzen versucht Charlie, ihr Leben zu meistern – als Mutter und Ehefrau. Joggen hilft ihr, den Körper zu spüren und Zuversicht zu gewinnen, auch wenn jeder Schritt schmerzt.
Gianmario, einst der Mann, auf den sich alle verlassen konnten, stürzte vor vier Jahren eine Treppe hinunter. Dabei wurde ein Tumor an einem Nerv entdeckt. Die Schmerzen, die er seitdem hat, beschreibt er als „schlimmste Zahnschmerzen im Bein“. Die Hoffnung, dass es nicht schlimmer wird, gibt ihm Kraft.
Verena Pförtner, Psychotherapeutin aus Potsdam, erklärt, dass bei chronischen Schmerzen die ursprüngliche Warnfunktion verloren geht. Der Schmerz wird zur Krankheit und verändert das Leben der Betroffenen.
Dr. Alessio Faliva, Schmerztherapeut aus Cremona, ergänzt, dass chronische Schmerzen eine Herausforderung sind – nicht nur für die Betroffenen, sondern auch für Angehörige. „Chronische Schmerzen können nicht geheilt werden“, sagt Faliva, „aber man kann lernen, mit ihnen zu leben.“


Edgars Leben nahm vor drei Jahren eine Wende: Zeitgleich erhielten seine Eltern die Diagnose Demenz. Die Anspannung, seine Mutter zu betreuen, die nebenan wohnt, während sein Vater im Pflegeheim lebt, brachte ihn bis zur totalen Erschöpfung. Hilfe fand er bei Sophía Amor, einer Psychologin und Gerontologin, die ihn bei der Bewältigung seiner Wut, Trauer und Schuldgefühle unterstützte. Inspiriert von seiner Leidenschaft für das Meer begann Edgar, Katamarantouren für Menschen mit Demenz und deren Familien zu organisieren. Das Meer heilt alles, hoffte er. Diese Fahrten schaffen gute Gefühle für alle an Bord auch, wenn die Erinnerungen nicht beständig sind.
Fabian (58), ein ehemaliger Boxer, lebt mit einer frühen Form der Demenz. Er lebte gesund, ist körperlicher fit und leidet dennoch unter Gedächtnislücken und Orientierungslosigkeit. Ihn belastet seine Situation sehr auch, dass er in Gedächtnisgruppen meist der Jüngste ist. Er versucht zu lernen, im „Hier und Jetzt“ zu leben.
Sarah pflegte als junge Frau ihre demente Großmutter. Das hat ihren Lebensweg entscheidend beeinflusst: Heute hilft die Psychologin sowohl Betroffene als auch Angehörige.
Dr. Wenzel Glanz, Neurologe und Leiter der Gedächtnissprechstunde an der Uniklinik Magdeburg, betont die Bedeutung der Früherkennung. Bereits 15 Jahre vor den ersten Symptomen können Hinweise auf Alzheimer im Nervenwasser gefunden werden. Neben Diagnostik und Therapie liegt ihm die Prävention am Herzen: Mit einem gesunden Lebensstil und der Reduzierung von Risikofaktoren können Erkrankungen wie Alzheimer oft vermieden werden.


Bei Alisia (25) begann die Magersucht in der Corona-Pandemie. Auf sich zurückgeworfen, war die Kontrolle über ihren Körper eine Art Halt. Sie wog 38 Kilo, als ihr eine Ärztin sagte, sie hätte noch zwei Wochen zu leben. Die verzweifelte Mutter wollte mit ihr einen Grabstein aussuchen, da erst legte sich bei Alisia ein Schalter um. Mithilfe einer Beraterin kämpft sie sich zurück ins Leben. Sie will Erzieherin werden und Jugendlichen mit ihren Erfahrungen helfen.
Finn (26) war schon als Kind übergewichtig. Als Teenager aß er oft unkontrolliert, gefolgt von Schuldgefühlen und Hungerphasen. Er hatte Angst, im Schlaf zu sterben. Dass er an Essstörungen litt, war ihm lange nicht klar. Ein Klinikaufenthalt in diesem Jahr brachte die Wende. Finn nahm 40 Kilo ab und übt mit einem Essensplan einen normalen Umgang mit Essen.
Jamy (25) wurde als Kind wegen ihres Gewichts gemobbt. Dazu kamen ihre Vorbilder auf Social Media. Sie begann exzessiv zu hungern, Sport zu treiben und Essen wieder auszukotzen. Jamy verlor das Gefühl für ihren Körper. Nach neun Monaten Klinik geht es ihr besser. Sie versucht, mehr im echten Leben zu sein als online.
Prof. Katrin Giel erforscht in Tübingen, wie sich Essgestörte in der virtuellen Realität selbst erleben. Mit Elektroden wird versucht, ihr Gehirn zu stimulieren. Der Londoner Psychiater Chukwuemeka Nwuba („Dr. Chucks“) kämpft dafür, dass die Krankheit in allen ethnischen Gruppen ernst genommen wird. Sein Buch „Eating Disorders Don’t Discriminate“ zeigt Erfahrungsberichte.
Ich und Hypochondrie
Ein Film von Silvia Palmigiano und Stella Könemann
jetzt in der arte-Mediathek!


Meike ist jung, gesund und hat jeden Tag Angst am Herzinfarkt zu sterben. In schlimmen Phasen ihrer Krankheit kann sie nicht aus dem Haus gehen. Jetzt ist sie schwanger und freut sich auch auf das Kind. Die Angst vor der Geburt ist zwar groß, aber eine Therapie hilft Meike dabei, Strategien zu finden damit umzugehen.
Nora hat alles: Familie, Freunde, Erfolg im Beruf. In ihrem Inneren sieht es anders aus: Die 45-jährige leidet unter Krankheitsangst. Manchmal wird sie so übermächtig, dass sie Stunden auf Parkplätzen verbringt. Erst eine Therapie zeigt Wirkung. Nora lernt, ihrer Angst zu begegnen, statt vor ihr wegzulaufen. Das fängt damit an, dass sie lernt ihren Hals abzutasten und nicht bei jedem Knubbel an Krebs zu denken.
Benjamin war 24, als er seine erste Panikattacke erlebte. Er dachte, es sei der Stress. Doch seitdem drehten sich seine Gedanken nur noch um Krankheit und Tod. Sein bester Freund Max machte damals Scherze, an was er wohl heute stirbt. 12 Jahre später nutzt Benjamin seine Erfahrung, um anderen zu helfen. Es unterstützt Menschen mit Krankheitsangst. Er weiß: Ihr Schmerz ist real.
Anna Pohl und Léonor Fasse sind Expertinnen für Krankheitsangst. Sie wissen, die Erkrankung kann jeden treffen kann – unabhängig von Alter oder Geschlecht. Auslöser sind oft normale Symptome wie Herzrasen oder Schwindel, die als lebensbedrohlich fehlgedeutet werden. Die Scham ist groß, die Betroffenen fühlen sich unverstanden und isolieren sich. Professionelle Hilfe ist für beide essenziell, um Strategien gegen die Angst zu entwickeln.
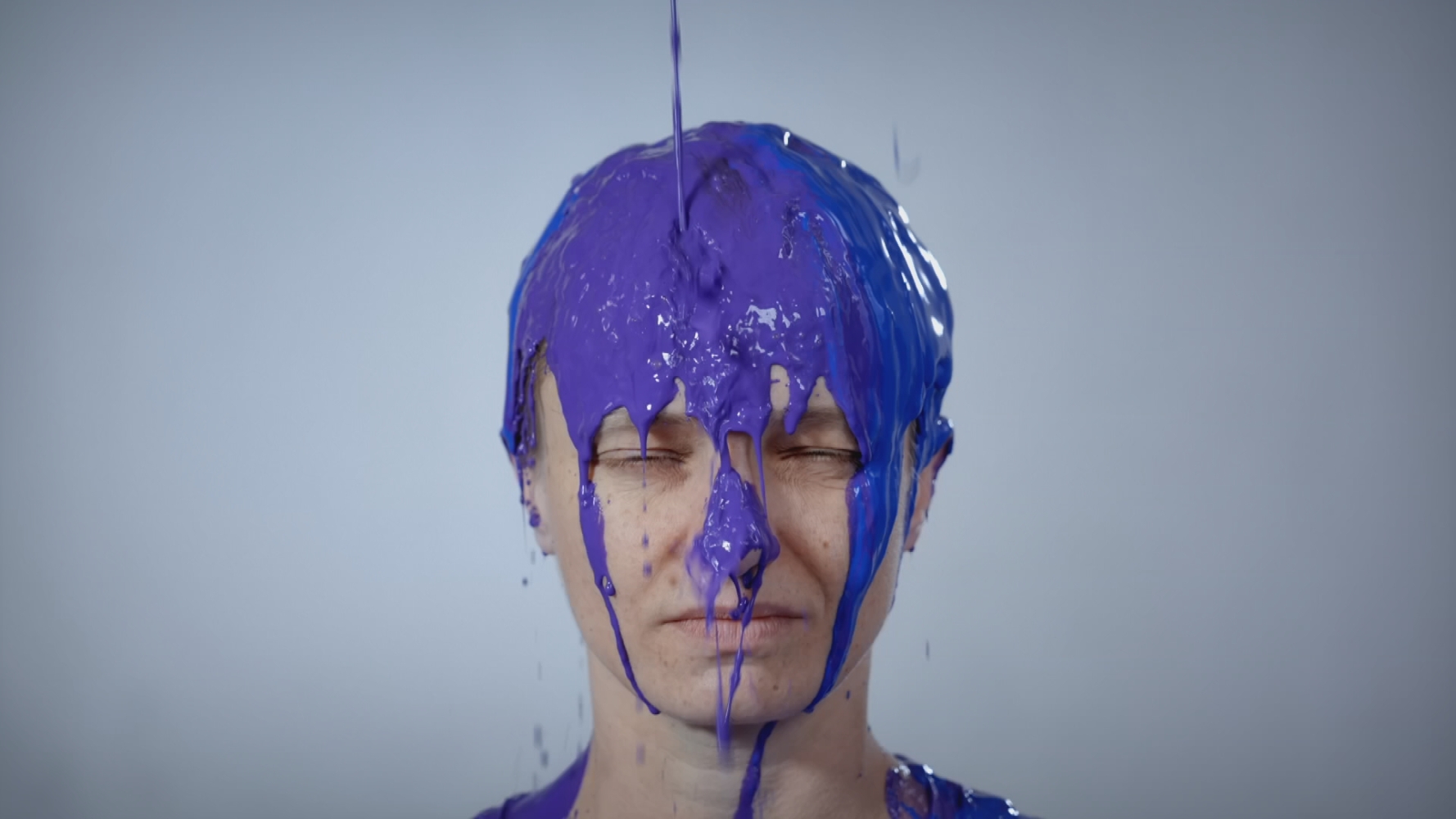

Mobbing macht krank. Die Opfer dieser Gruppenquälereien leiden nicht nur während der Schikanen, sondern oft noch Jahre später. Häufig wissen sie nicht genau, warum und bringen gescheiterte Beziehungen oder Ängste nicht in Zusammenhang mit den längst vergangenen Erlebnissen.
So ging es auch Maxime. Erst in seiner Therapie wurde ihm klar, dass es die psychische Gewalt aus Kindertagen war, die dem heute 32-Jährigen im Weg steht. Mithilfe von Techniken, die für eine Traumabehandlung entwickelt wurden, verarbeitet Maxime nach und nach die schmerzhaften Erinnerungen an den Schulhof.
Einer, der selbst Teil einer Mobbergruppe war, ist David. Noch Jahre später denkt er an das Opfer ihrer Attacken. Warum er damals mitgemacht hat, weiß der heute über 30-Jährige genau: Besser leidet er als ich!
Mobbing ist ein System, das nur in der Gruppe funktioniert: Ist die Angst jedes Einzelnen groß genug selbst Opfer zu werden, hört keiner auf. Genau dagegen kämpft Inès. Die französische Anwältin ist spezialisiert auf Mobbing am Arbeitsplatz. Ihr Antrieb, anderen zu helfen, die bei der Arbeit gequält werden, ist ihre eigene Geschichte: Sie erlebte selbst Ausgrenzung und Demütigungen und wurde krank. Damals beschloss sie, mit juristischen Mitteln dagegen zu kämpfen.
Thomas Villemonteix ist Psychologe in Paris. Er will aufklären. Möglichst viele Menschen sollen verstehen, wie Mobbing funktioniert und für die Schwere der Folgen sensibilisiert werden. Es beginnt im Kindergarten, wo den Kleinsten spielerisch erklärt wird, wie sich der fühlt, der gemobbt wird.


Schizophrenie macht Angst: nicht nur den Betroffenen, die unter Halluzinationen leiden oder sich bedroht und verfolgt fühlen, sondern oft auch den anderen. Es ist vielleicht die psychische Störung mit dem größten Stigma: Schizophrene sind komisch, gar gefährlich.
Auch Julie hat mit dem Stigma zu kämpfen. Krebs wäre ihr lieber gewesen, kommentiert die Diagnose eine Freundin. Trotz solcher Erfahrungen erkämpft sich die Masseurin ihr eigenes Leben: Gemeinsam mit ihrem Partner entscheidet sie sich Mutter zu werden und erfährt von ihrer Therapeutin viel Unterstützung.
Wie wichtig eine gute und frühzeitigen Behandlung ist, weiß auch Hannah. Mit 17 Jahren hat sie erste Symptome, glaubt vergiftet worden zu sein und wird Todesangst in Psychiatrie eingeliefert. Ihr Glück: Die medikamentöse Behandlung hilft, und sie kann sich erholen. Heute gilt die junge Frau als geheilt und studiert Mathematik.
Der Hintergrund der Symptome scheint der Botenstoff Dopamin zu sein: dessen Konzentration ist entweder ungewöhnlich hoch oder niedrig. Zusätzlich zu Medikamenten, die das regulieren sollen, sind Therapien wichtig.
Cedric musste einen Rückfall hinnehmen: Nach einer ruhigen Phase, wurde er nachlässig. Die Wahnvorstellungen kamen zurück: Mit einer Statue der Jungfrau Maria im Arm lief er durch die Straßen. Seine Mutter hilft ihm sich zu stabilisieren. Auch die Forschung weiß, dass ein zugewandtes Umfeld ein wichtiger Faktor bei der Bewältigung der Störung ist. Heute geht es Cedric gut. Er engagiert sich in einem Verein, der sich bemühte, Schizophrenie zu entstigmatisieren.
Ich und Therapie
Ein Film von Alba Vivancos Folch und Maya Perusin Mysorekar
jetzt in der arte-Mediathek!


In Therapie gehen nur Verrückte. Ein echter Mann löst seine Probleme selbst. So oder ähnlich denken viele über den Gang zu Therapeut*innen. Dabei ist die Forschung sich schon seit Jahrzenten sicher: Therapie wirkt! Hier erzählen drei Betroffene von ihren Erfahrungen und wie sie den Mut fanden sich Hilfe zu holen.
Shirin hat eine bewegte Reise hinter sich. Sie selbst beschreibt es als Achterbahnfahrt: Nach mehreren Therapieerfahrungen und Abbrüchen hat sie gelernt, authentisch zu sein. Es hilft nichts, dem Therapeuten gefallen zu wollen, sie muss ihre Bedürfnisse in den Vordergrund zu stellen. Ihr Beispiel zeigt, wie wichtig es ist, den richtigen Therapeuten zu finden und sich selbst nicht aus den Augen zu verlieren.
Julians Mutter ist an Krebs gestorben und er erzählt welcher psychische Druck damit einherging. Er suchte Hilfe und wurde weggeschickt: „nicht belastet genug“, so empfand er die Absage. Es geht ihm schlechter und er nimmt einen zweiten Anlauf: Mit Erfolg. Er wird in seinem Trauerprozessen begleitet und kann heilen. Seine Geschichte verdeutlicht, wie herausfordernd und zugleich befreiend der Weg zum Therapeuten sein kann.
Medhi hat den Weg in eine therapeutische Praxis lange gescheut. Erst wollte die Kontrolle nicht abgeben, dann dachte er, der Therapeut macht die Arbeit. Erst als er Tamila fand, ging es ihm besser. Die Psychologin kennt alle Vorurteile gegen Therapien, gibt regelmäßig Workshops, um aufzuklären. Besonders wichtig ist ihr die Supervision, also die Möglichkeit als Therapeutin das eigene Tun zu reflektieren.


Manuela (35) wurde 2010 Opfer einer Vergewaltigung. Sie verdrängte das Geschehen zunächst, doch es ging ihr immer schlechter. Sie hatte schlimme Alpträume, Flashbacks, Panikattacken und Dissoziationen. Schließlich konnte sie ihren Alltag nicht mehr bewältigen und ging in eine Trauma-Klinik. Dort machte sie eine Expositionstherapie IRRT. Dabei wird eine Beschreibung der Tat auf Tonband aufgenommen und das musste Manuale sich wieder und wieder anhören. Dazu lernte sie Techniken, um dissoziative Zustände zu verhindern. Ihr damaliger Mann Stephan unterstützte sie dabei. Nach Abschluss der Therapie 2023 kann Manuela wieder ein selbstbestimmtes Leben führen. Sie hat gelernt, klar zu kommunizieren und Grenzen zu setzen.
Marc (32) verloren 2024 seine kleine Tochter durch einen tragischen Unfall. Nach ihrem Tod entwickelte er eine Posttraumatische Belastungsstörung (PTBS) und entwickelte vor allem Dissoziationen. Alltägliche Dinge triggerten Erinnerungen an das Trauma. In seiner Therapie lernt er die belastenden Gefühle zu verarbeiten. Achtsamkeitsübungen und erlernte Techniken helfen ihm, mit Angst und Übererregung umzugehen. Er ist auf dem Weg der Besserung, weiß aber, dass eine vollständige Rückkehr in sein altes Leben schwierig ist.
Marit Treptow, Leiterin der Trauma-Ambulanz Göttingen, erklärt die Phasen der Traumatherapie: Psychoedukation, Stabilisierung, Exposition und Integration. Für sie ist es der schönste Moment, wenn Patient*innen die Expositionsphase überstanden haben und deutliche Verbesserungen spüren.


In der Folge „Ich und Zwang“ beleuchten wir die tiefgreifenden Auswirkungen von Zwangsstörungen auf das Leben der Betroffenen. Viele schweigen aus Scham über ihre Qualen. Und das sind nicht wenige: zwischen ein und drei Prozent der Bevölkerung leidet unter Zwangsstörungen.
Sarah, die heute 31 Jahre alt ist, leidet schon seit ihrer Kindheit an Zwängen, die sich aber immer kaschierte. Als junge Frau begann sie intensiv an Kontaminationsängsten zu leiden. Sie musste zwanghaft alles klinisch reinigen und konnte keine frischen Lebensmittel mehr zu sich nehmen. Nach zehn Jahren gab es in ihrem Leben nichts mehr, dass ihr Freude bereitete. Sie dachte an Suizid. Eine innovative Behandlung aber konnte 90 Prozent ihrer Zwänge überwinden. Heute führt Sarah ein normales Leben.
Raphaël erlebte ersten Zwangsgedanken in der Pubertät, ausgelöst durch die Scheidung seiner Eltern. Sein Waschzwang führte dazu, dass der 31-Jährige sich täglich bis zu 100-mal die Hände waschen musste. Zusehens isolierte er sich. Eine Freundin sprach ihn an und half ihm mit Hilfe einer Verhaltenstherapie den Weg zurück in ein normales Leben zu finden.
Johanna kämpfte mit Gedanken, die sie rund um die Uhr abwerten. Die 25 Jahre alt Frau wollte nur noch sterben. Erst die Entscheidung, in eine Klinik zu gehen, brachte die Wende. Um ihren Kampf zu entstigmatisieren, nennt sie ihre Zwangsstörung liebevoll „Dora“.
Dachten Experten früher, dass Zwangsstörungen schwer zu heilen sind, ist heute das Gegenteil bewiesen: Verhaltenstherapien, die die Betroffenen mit ihren Zwängen konfrontieren haben große Erfolge.

