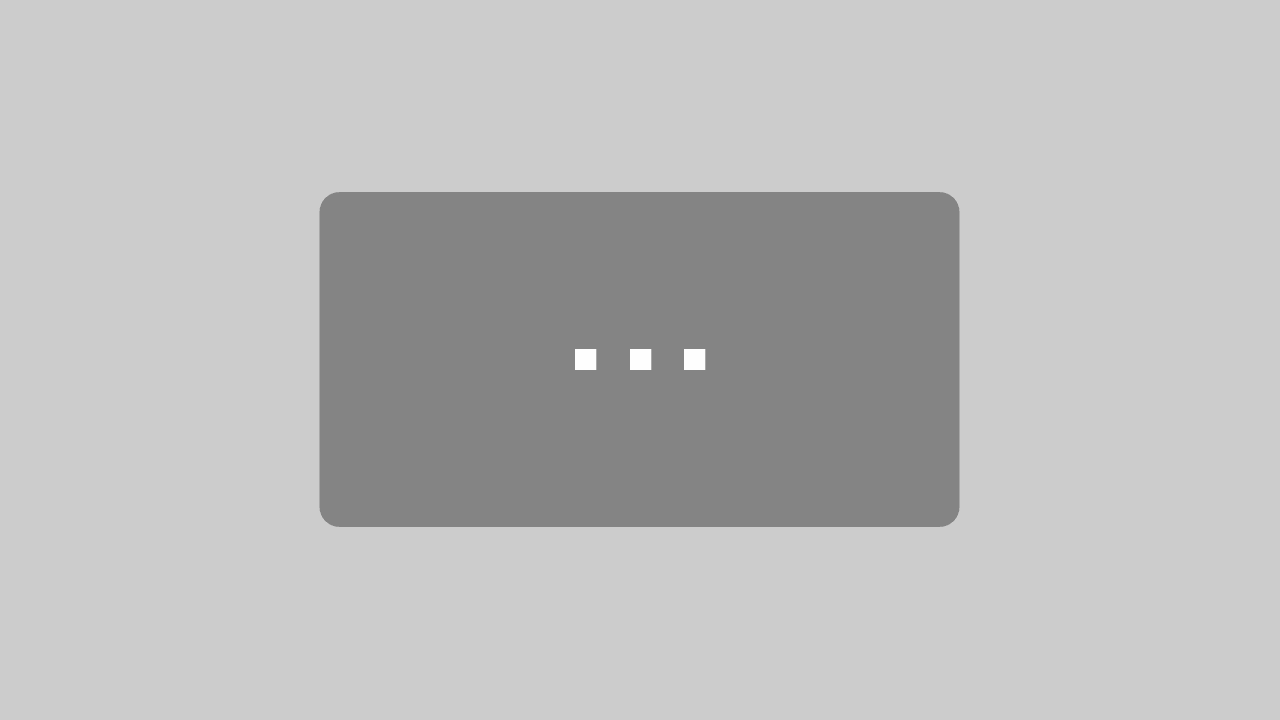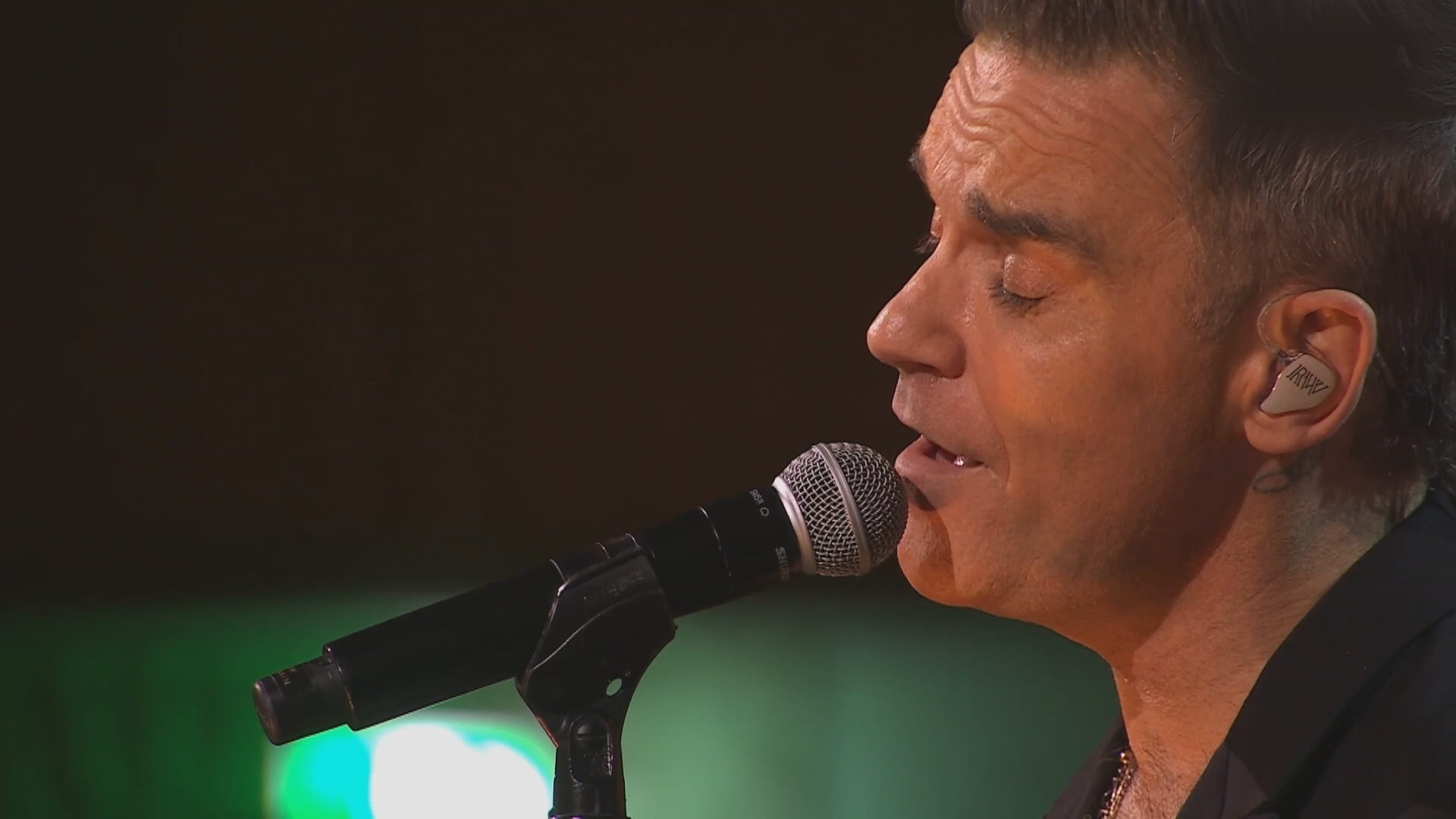Bones – Die Jagd nach Dinofossilien
Bones – Die Jagd nach Dinofossilien
Ein Film von Jeremy Xido, in Ko-Produktion mit Intuitive Pictures, 2023
Auf internationalen Märkten erzielen Dinosaurier-Fossilien seit einigen Jahren Preise in Millionenhöhe. Dabei konkurrieren besessene Sammler mit Museen und Wissenschaftlern darum, ein Stück der Vergangenheit zu besitzen. Es ist die die Geschichte eines illegalen Raubzuges voller Intrigen an der Schnittstelle von Wissenschaft und kommerziellem, nicht immer legalen Handel.
Der Dokumentarfilm von Jeremy Xido, produziert von Intuitive Pictures (Oscar-Nominierung 2023 für „Fire & Love“) und Berlin Producers Media, ist internationaler Thriller ebenso wie filmische Meditation über die Natur des Daseins und folgt unterschiedlichen ProtagonistInnen: Einem deutschen Wissenschaftler mit marokkanischen Wurzeln, der im Atlas-Gebirge im Wettlauf mit Fossilienräubern steht, einer mongolischen Paläontologin, die dafür kämpft, die Knochen an ihren Fundort zurückzubringen, an dem sie geplündert wurden, einem französischen Fossilienhändler mit zweifelhafter Reputation, einem italienischen Auktionator in Diensten eines Pariser Auktionshauses und Jack Horner, Vorbild für die Figur des Paläontologen Alan Grant aus „Jurassic Park“, der zuversichtlich ist, die DNA von Dinosauriern rekonstruieren zu können und sie so zum Leben zu erwecken